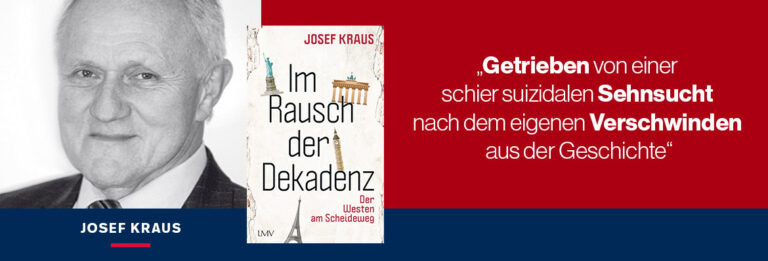Erste Szene: Taufgottesdienst am Sonntagmorgen. Die Familie des Täuflings und die übrige Festgesellschaft fallen unter die Kategorie „kirchenfern“. Man bemerkt das an der Unsicherheit bei den liturgischen Teilen des Gottesdienstes, dem Aufstehen und Hinsetzen oder der Form des Wechselgesangs. Man merkt es aber vor allem an der kaum hörbaren Antwort auf die Frage des Geistlichen an Eltern und Paten – und an deren fortwährendem Kaugummikauen. Zweite Szene: Gespräch mit einem jungen Vikar der lutherischen Landeskirche nach dem ersten Aufenthalt im Predigerseminar. Er berichtet über den Einführungsvortrag, bei dem man die zukünftigen Pastoren darüber informiert habe, daß mit einem weiteren Rückgang des evangelischen Bevölkerungsteils gerechnet werde, von gegenwärtig etwa 30 auf weniger als 20 Prozent. Auf die Frage, was man dagegen tun wolle, folgt ein etwas betretenes Schweigen und dann der leicht amüsierte Hinweis, daß nur die „Pietisten“ im Vorbereitungskurs die Idee eines missionarischen Gemeindeaufbaus vorgetragen hätten. Dritte Szene: Am Werkzeugstand eines Heimwerkermarkts. Drei Jungen, zwischen zehn und fünfzehn Jahren etwa, beratschlagen über den Kauf einer Säge. Sie tragen alle „Jujas“, Jungenschaftsjacken, und machen einen prächtigen Eindruck. Auf die Frage, zu welchem Bund sie denn gehören, kommt ein knappes aber freundliches „Jugendbund Phönix“, dann wird noch hinzugefügt: „Wir sind die Gemeindejugend der Stadtkirche“. Was die erste Szene angeht, so wäre schlimmeres leicht auszumalen. Wer außerhalb von Restgebieten geschlossener Kirchlichkeit lebt, wird vergleichbare Erfahrungen gemacht haben: angefangen bei stehenden Ovationen für den Chor, der im Gottesdienst die Bachkantate singt, über Kindermetten am Heiligabend, die in einem lärmenden Chaos versinken, Konfirmationsfeiern, bei denen sich die Hauptpersonen mit SMS-Botschaften unterhalten, Jugendliche in Freizeitkluft, die mit den Händen in den Hosentaschen auf die Gaben des Abendmahls warten oder Witze beim Totengedenken reißen. Der Zusammenbruch der guten Sitten ist natürlich nicht auf die Kirche und schon gar nicht auf die evangelische beschränkt (in Italien mußte ein Gesetz erlassen werden, um zu regeln, was man in einem Kirchengebäude alles nicht tun darf), aber im protestantischen Bereich ist der Grad der Verrottung besonders hoch, und vor allem gibt es keinen Widerstand dagegen. Das hat vor allem mit dem Typus zu tun, den man heute bevorzugt in den Pfarrämtern findet, weich, auch die Männer feminisiert, in der Sprache undeutlich, irgendwie an Selbsterfahrungsseminaren geschult, keinesfalls am Lutherdeutsch. Diese Geistlichen strahlen keine Autorität aus, und selbst wenn sie die Mißstände als solche erkennen – was keineswegs immer der Fall ist – reagieren sie hilflos. Ihr Vertrauen in das gute Zureden kennt keine Grenzen. Sie sind damit ein getreues Spiegelbild ihrer Führung. Die Stellungnahme der EKD zum Thema „Manieren“, die im Frühjahr 2004 veröffentlicht wurde, beschränkt sich ganz auf das Deklamatorische. Der Protestantismus weiß immer weniger, was sein Eigentliches ist. Dieser Orientierungsverlust ist das Ergebnis eines seit langem anhaltenden Abbaus geistlicher Substanz, den man zwar immer wieder aufzuhalten suchte, aber ohne durchgreifenden Erfolg. Die heute in den Kirchenleitungen wie in der Pastorenschaft dominierenden Theologen hatten lange Zeit auf eine konsequente Politisierung der Kirche gesetzt. Nun gibt es zwar immer noch Landesbischöfinnen, die meinen, daß das „Evangelium von Solentiname“ der christlichen Weisheit letzter Schluß sei, aber das kryptische Wort von Heinrich Albertz, verglichen mit der evangelischen Kirche erscheine die SPD als rechtsradikale Organisation, hat an Richtigkeit eingebüßt. Der Sieg der kirchlichen Linken hat sie zur Mäßigung gezwungen, weil sie einen Blick für die Gegebenheiten entwickeln mußte, und die wichtigste Gegebenheit ist der Schwund: der Schwund der Mitglieder, der Schwund der Gelder, der Schwund der sozialen Bedeutung. Darauf reagiert man mit administrativen Maßnahmen, verfehlten Übernahmen von Marketing- und Managementrezepten und einer Neuauflage des „Kulturprotestantismus“. Der Begriff hatte seit dem Ende des Ersten Weltkriegs eigentlich nur noch die Funktion des Unworts; die Barthianer waren dagegen, die Progressiven waren dagegen, die Konservativen waren dagegen, und die Frommen waren erst recht dagegen. Jetzt ist man dafür, verkennt allerdings, daß der Kulturprotestantismus ein sekundäres Phänomen war, Teil einer liberalen Gesellschaft, die ihrerseits ein sekundäres Phänomen war, das heißt, daß sie auf Voraussetzungen beruhte, die sie weder herzustellen noch zu erhalten wußte. Diese Voraussetzungen sind längst aufgezehrt, mutwillig zerstört oder vergeudet. Trotzdem ist die Bereitschaft im Protestantismus gering, sich auf den Kern zu besinnen oder wenigstens von dem abzulassen, was entscheidend zur gegenwärtigen Misere beigetragen hat. Da ist vor allem die Unverbindlichkeit zu nennen, eine Laxheit in bezug auf Lehre, Gottesdienst und Gemeindeordnung, die seit den sechziger Jahren immer stärker um sich griff, und von der fast nur die Evangelikalen und die Freikirchen ausgenommen blieben. Die „offene“ Jugendarbeit war dafür immer ein besonders wichtiger Indikator, gemeint ist das absurde Konzept, mit einer Mischung aus Party, Gruppendynamik und Dritte-Welt-Laden so etwas wie eine evangelische Identität der Heranwachsenden zu fördern. Das Scheitern dieses Ansatzes ist seit langem offenkundig, und mittlerweile gibt es beherzte Pfarrer, die sich bei Pfadfinderbünden zur Schulung anmelden, um nicht nur den Aufbau eines Zeltes und das Entfachen eines Lagerfeuers zu lernen, sondern auch, um ein pädagogisches Mittel zu gewinnen, das Bindung schaffen kann. Die Chance, durch eine entsprechende Atmosphäre die Ernsthaftigkeit vorzubereiten, die für die Glaubensunterweisung nötig ist, erscheint jedenfalls ungleich größer als im Fall des offenen Ansatzes. Das ist immerhin ein Anfang und ein Hinweis darauf, daß die Regeneration des Protestantismus, wenn überhaupt, dann nur von unten nach oben möglich scheint, von den Gemeinden ausgehend, von der Basis, von Fall zu Fall. Das ist mühsam, aber kein Grund zur Verzweiflung, bedenkt man das Herrenwort vom Senfkorn, das aufwächst zum Baum.