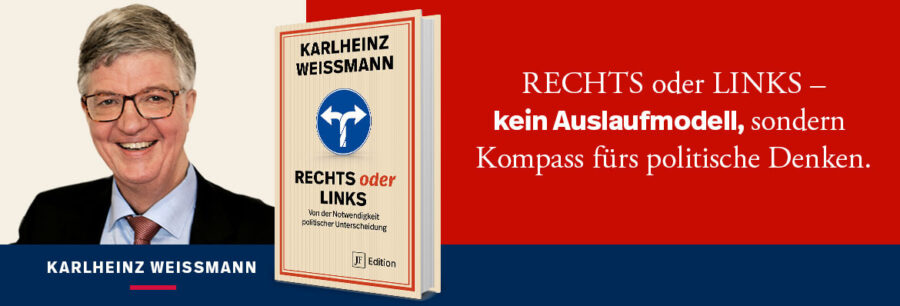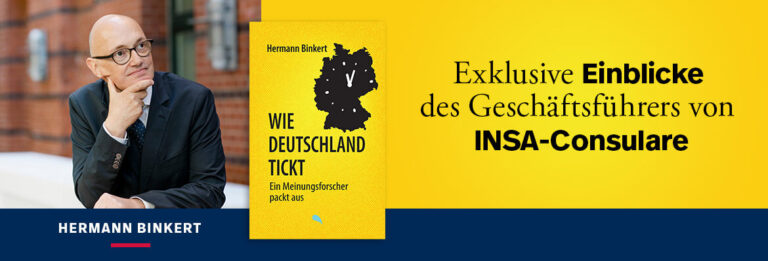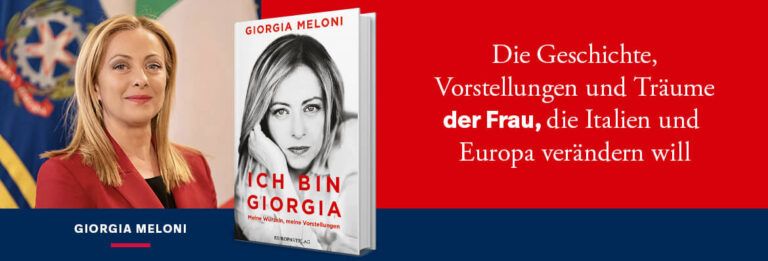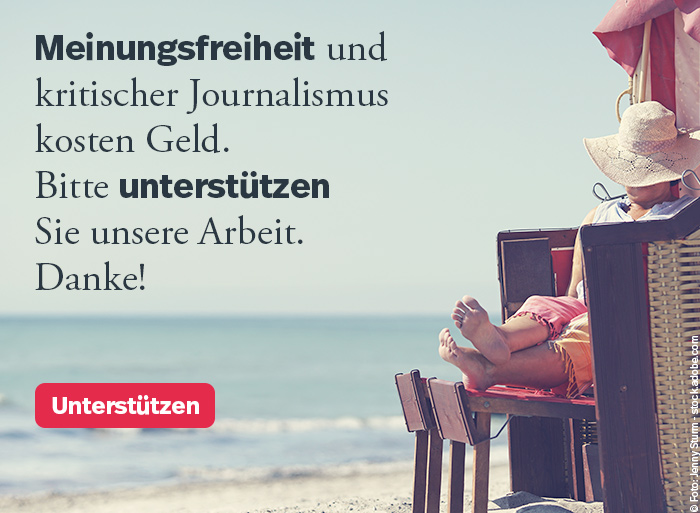Schreiben Sie die Wahrheit, fordern ihn Georgier, Abchasier oder Südosseten auf: nicht nur einmal immer wieder. Der Angesprochene, Jonathan Littell, der in seinem Roman Die Wohlgesinnten (2006) die psychische Wahrheit über einen NS-Täter erkunden wollte, hatte sich im August 2008 als Journalist für Le Monde nach Georgien begeben, um die faktische Wahrheit über den Krieg mit Rußland zu schreiben. Aber wie läßt sich das bewerkstelligen, wenn die Wahrheit so komplex ist, daß alle Parteien sie als Rohstoffreservat für eigene Vorurteile ausbeuten? Ein Problem, das sich jedem Journalisten stellt. Der Autor weicht ihm nicht aus, sondern reflektiert seine Recherchen auf dieser Metaebene. So ist sein Bericht zugleich ein Essay über die Unmöglichkeit, die Wahrheit zu schreiben. Gleich zu Beginn konfrontiert Littell die unvereinbaren Versionen des Konflikts miteinander. Da läßt sich kein wahrer Kern herauskristallisieren. Also fragt er nach der Entstehung dieser Erzählungen. In Rußland wird das von staatlich gesteuerten Medien besorgt, während Georgien ganz auf der Höhe der Zeit eine belgische PR-Firma mit diesem Job beauftragt hat. Deren Manipulation der Fakten ist subtiler, zumal der Firmenchef sie selbst zu glauben scheint. In Georgien gestattete der Sekretär des Sicherheitsrates ihm und anderen Journalisten eine Besichtigungstour und Bewegungsfreiheit an der ossetischen Grenze. So ließen sich Einwohner interviewen, die inmitten von zertrümmerten Inventar, verhungerten Tieren und Blutlachen hausten. Die russische Besichtigungstour dagegen wurde von einem Mini-Goebbels geleitet, der absurde Behauptungen zum besten gab: So erklärte er die Zerstörung georgischer Häuser als pure Unfallsexplosion. Der Sekretär des georgischen Sicherheitsrates (Das ist ein Spiel) verrät, daß die Georgier sich opferten, damit die Welt die Gefahr des widererstarkten Rußlands erkenne Littell, mit der Ansicht des Sekretärs keineswegs konform, begreift, daß dies seiner innersten Überzeugung entspricht, daß sie nicht Erfindung ist, sondern seine Wahrheit, die Wahrheit, in der er lebt. Spätestens hier greift eine Melancholie Raum, die aus Kurosawas Film Rashomon (1950) vertraut ist. Darin führt der Versuch, ein Verbrechen mit Hilfe von Zeugen zu klären, in die Resignation. Denn man hört nur widersprüchliche Versionen, und jeder hat seine ganz eigene Wahrheit. Jonathan Littell: Georgisches Reisetagebuch. Aus dem Französischen von Heiner Kober, Berlin Verlag 2008, kartoniert, 55 Seiten, 5 Euro