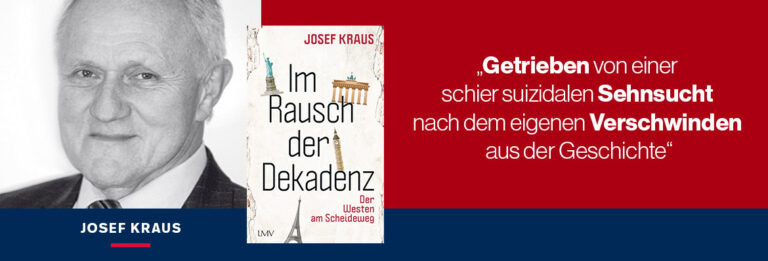Stirners Bedeutung steht außer Zweifel; sie kann nicht überschätzt werden. Er hat das Geheimnis erfaßt, das sich in jedem Menschen verbirgt, das ihn im Wechsel des Weltlaufs erhält und ihm Würde verleiht.“ Der, den Ernst Jünger hier in einem Tagebucheintrag („Siebzig verweht“, 28. November 1977) so überaus hochschätzte, hatte diese Entdeckung gut hundertdreißig Jahre vorher beschrieben. Im Herbst 1844 erschien „Der Einzige und sein Eigentum“. Max Stirner sagte gleich eingangs, wen er mit seinem einzigen Buch treffen wollte: „Was soll nicht alles meine Sache sein! Vor allem die gute Sache, dann die Sache Gottes, die Sache der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der Humanität, der Gerechtigkeit; ferner die Sache meines Volkes, meines Fürsten, meines Vaterlandes; endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen. Nur meine Sache soll niemals meine Sache sein. ‚Pfui über den Egoisten, der nur an sich denkt!‘ Sehen wir denn zu, wie diejenigen es ihrer Sache machen, für deren Sache wir arbeiten, uns hingeben und begeistern sollen.“ Wie es sich hier schon ankündigt, so ist das ganze Buch buchstäblich eine „Unverschämtheit“. Stirner, mit bürgerlichem Namen Johann Caspar Schmidt, verschonte niemanden; ungerührt hielt er den Egoisten und den Egoismen aller Spielarten den Spiegel vor, drehte jeden Stein um und griff jede Autorität an, ob sie nun von Kirche, Staat, Partei, Individuum oder Gesellschaft verkörpert wurde. Jahrzehnte bevor Nietzsche den Willen zur Macht als Erkenntnisschlüssel proklamierte, hatte Stirner ihn in Gestalt des allgegenwärtigen Egoismus gefunden und darüber hinaus auch bereits die geistige Haltung skizziert, die ihm allein geeignet schien, in diesem Spiel die persönliche Souveränität zu behalten. Das alles war ihm „Meine Sache nicht“, wie eins seiner zentralen Axiome lautete, „Nichts geht über mich“ ein anderes. „Zu absurd, um gefährlich zu sein“ Naturgemäß wurde dies gern als negativer Egoismus verstanden, der sich aus moralischer Verkommenheit gegen die vielen guten Dinge wendet, die nach deren Anspruch vorgeblich von den bereits gesetzten Werten aller Art verkörpert werden. Dies war nicht so gemeint, denn Stirner wollte keineswegs den aktiven Anarchismus predigen, und genau dies machte ihn später für Ernst Jünger so attraktiv. „Stirner hätte um ein Haar den Punkt getroffen, an dem ich den Anarchen vermutete“, läßt er im Roman „Eumeswil“ (1977) seinen Protagonisten Manuel Venator sagen. Ganz im Stil des Anarchen war Stirners Einziger kein militanter Gegner des Bestehenden. Der Sturz der vorgefundenen Ordnung war so wenig Seine Sache wie ihre Unterstützung. „Stirner läßt sich auf Ideen, insbesondere auf Beglückungsideen, nicht ein. Er sucht die Quelle des Glücks, der Macht, des Eigentums, der Göttlichkeit in sich; er will nicht dienstbar sein.“ Es überrascht daher nicht, daß „Der Einzige und sein Eigentum“ sofort auf Widerspruch traf, vor allem aber auf eine gewisse Ratlosigkeit. Das Buch erschien in Leipzig und wurde sofort beschlagnahmt. Der dortige Innenminister hob das Verbot auf, weil das Werk „zu absurd ist, um gefährlich zu sein“, in Preußen blieb es verboten. Noch irritierter reagierten alte Bekannte, die früher des öfteren gemeinsam mit Stirner in Hippels Weinstube debattiert hatten, in Berlin, Friedrichstraße 94. Wer sich bei Hippel traf, wurde damals der äußersten Linken zugerechnet. Das drückte sich in einer Teilnehmergruppe aus, unter der neben Stirner und zahlreichen mehr oder weniger heute noch bekannten Radikalen auch Karl Marx und Friedrich Engels zu finden waren. Diese verabschiedeten sich aber bald aus der Reihe der „Freien“, wie die Debattierrunde genannt wurde. Man könnte auch sagen, sie flüchteten aus gutem Grund. An Stirner biß sich der Marxismus bereits die Zähne aus, bevor er überhaupt so recht formuliert war. Marx und Engels sahen die Herausforderung und versuchten ihr mit einem Pamphlet über die „Deutsche Ideologie“ zu begegnen, in dem sie ein Hauptkapitel für Stirner reservierten. Hinter Stirners Feststellung, ich kann alles zu meiner Sache machen, aber nichts zu Meiner Sache, liegt der radikalste Angriff verborgen, der je gegen ihre Sache geführt wurde. Wo Karl Marx in der Aufhebung des Eigentums das letzte Ziel sah, fand Stirner keinen Handlungsbedarf. Der Abschaffung des Eigentums stellte er seine uferlose Ausdehnung gegenüber: Dem Einzigen gehört ohnehin die ganze Welt. Welchen Teil er davon direkt nutzt, ist Sache seines „Vermögens“. Fremde Eigentumsansprüche erkennt er grundsätzlich nicht an, erwartet aber auch von anderen, seine Eigentumsansprüche nicht anzuerkennen. Politik wollte Stirner nicht zu seiner Sache machen Marx wollte seinen erlösten Menschen später aus der Entfremdung befreien, indem er ihm statt eines Berufs mehrere überstülpte und steten Wechsel verordnete. Jeder soll morgens Fischer und abends Kritiker sein können, heißt es an der einzigen Stelle, an der er eine Konsequenz seines Denkens zu ziehen versuchte und einen Blick ins kommende Paradies warf. Stirner dagegen hatte erkannt, daß die Differenz zwischen dem Individuum und seiner jeweiligen Beschäftigung ebenso permanent wie unaufhebbar besteht. Sich dieser Differenz bewußt zu sein und sie auszuhalten gibt dem Menschen gerade jene Würde, die Jünger durch Stirner erfaßt sah. Diese Tatsache kann demnach nicht durch ein Bäumchen-wechsel-dich-Spiel umgangen werden, etwa indem jeder abwechselnd der Pförtner, der Arbeiter und der Chef sein sollte, wie August Bebel vor dem Deutschen Reichstag in würdiger Einfalt die Geographie des kommenden marxistischen Wunderlands kolorierte. Der Hohn der übrigen Fraktionen für diese jenseits aller Realität positionierte Phrase knüpfte spontan an der Person Bebels an, hatte der gelernte Tischler doch zu dieser Zeit bereits Jahrzehnte an der Spitze der Sozialdemokratie verbracht und machte keine Anstalten, es noch einmal als Pförtner versuchen zu wollen. Diesem Vorbild gemäß neigten Sozialisten im Zweifelsfall auch künftig stets zum Egoismus, allenfalls hauchten sie ein letztes „Ich liebe euch doch alle“, wenn im fortgeschrittenen Greisenalter der Chefsessel doch aufgegeben werden mußte. Stirner hätte sich darüber nicht aufgeregt. „Unbewußt streben wir alle der Eigenheit zu. Aber ein unbewußtes Tun ist ein halbes, und immer wieder fallt ihr in die Hände eines neuen Glaubens – ich aber sehe lächelnd der Schlacht zu.“ Mitte der 1960er Jahre lag Stirners Werk dem kommenden Aufstand der Achtundsechziger immer noch als Monolith im Weg. Viele hundert Seiten hatten Marx und Engels dem Versuch gewidmet, ihn beiseite zu räumen. Das war nicht gelungen, im Gegenteil verschwand ihr Manuskript lange Zeit in der Versenkung. Mit dem Sozial- und Wirtschaftshistoriker Hans Helms machte sich nun zu dieser Zeit jemand auf, dies nachzuholen, und schwang dabei kräftig eine neuentwickelte Waffe, die den Gründervätern des Marxismus noch nicht zur Verfügung gestanden hatte: die Faschismuskeule. „Die Ideologie der anonymen Gesellschaft“, nämlich der damals aktuellen bundesdeutschen, sei nichts anderes als faschistisch und dies bereits seit mehr als hundert Jahren. In dieser Deutung der neueren deutschen Geschichte als eine Art „Faschismus von Stirner bis Adenauer“ gab es für Helms nirgendwo einen Bruch. „Stirnerismus und Nationalsozialismus“ erklärte er kurzerhand zu Variantionsformen desselben „faschistischen Ungeists“. Weshalb aber sollte nun der Einzige, der jede rückhaltlose Parteinahme kategorisch ablehnte, gerade zum Urahn einer Führerbewegung der totalen Treue geworden sein? Es mußte schon eine besondere Dialektik sein, die den Graben zwischen „Nichts geht über mich“ und „Du bist nichts, dein Volk ist alles“ überbrücken konnte. Da ihm dieser Brückenbau nicht gelang, suchte Helms Ersatz, wies den immanenten Faschismus des aufgeräumten Wohnzimmers ebenso nach wie den der gutgekleideten Hausfrau. Weiter verwies er auf Mussolini, der zu seinen Sozialistenzeiten als passionierter Stirner-Leser bekannt war und 1911 in einem Brief aus dem Gefängnis davon gesprochen hatte, er sei nach der Lektüre der Geistesriesen Goethe, Schiller, Nietzsche und Stirner „ein echter deutsch“ geworden. Helms führte weiter die mutmaßliche Stirner-Lektüre Dietrich Eckarts an und hangelte sich schließlich zur Behauptung hoch, der „Einzige“ und „Mein Kampf“ seien „trotz oberflächlicher Widersprüche vollkommen miteinander zu vereinbaren“. Er tat sich viel darauf zugute, in Stirner den Kleinbürger und im Kleinbürger angeblich den Protofaschisten entlarvt zu haben. Für Jünger war dies banal und bestensfalls insofern richtig, als der Einzige in jedem stecke, also auch im Kleinbürger. Aber erst wenn die großen Egoisten es zu toll treiben, ihm gar ans Leben und die Existenz wollen, schlage selbst der Kleinbürger manchmal zurück, was nicht in Stirners Text gefordert, aber möglich sei: „Wie kommt es, daß der Kleinbürger teils als Popanz, teils als Prügelknabe von der Intelligenz, der Großbourgeoisie, den Gewerkschaften behandelt wird? Wahrscheinlich deshalb, weil er sich weder von unten noch von oben an die Maschine bringen lassen will. Gehts gar nicht anders, nimmt er die Geschichte selbst in die Hand. Ein Gerber, ein Tischler, Sattler, Maurer, Anstreicher, ein Gastwirt entdeckt in sich den Einzigen, und jeder erkennt sich in ihm.“ Stirner selbst beschloß nicht, die Politik zu „seiner Sache“ zu machen. Die Revolution von 1848 ließ er unbeteiligt verstreichen, wie die meisten der anderen „Freien“ auch. Er blieb ein gut kleinbürgerlicher Lehrer, verheiratet, aber kinderlos, offenbar mit wenig Glück in den geschäftlichen Unternehmungen, die er sonst noch anstellte. Mit fünfzig starb er an einem Insektenstich, der sich entzündete. Jünger ordnete ihn mit den Molltönen in die Reihe der ganz Großen ein, die sein Spätwerk gelegentlich kennzeichnen: „Antonius hat die Macht des Einsamen, Franziskus die des Armen, Stirner die des Einzigen erkannt. ‚Im Grunde‘ ist jeder einsam, arm und einzig auf der Welt.“ Foto: Max Stirner (1806-1856), gezeichnet von Friedrich Engels Zeit seines Lebens war der Schriftsteller Ernst Jünger (1895-1998) ein großer Leser. Mehr noch: Lektüre stellte einen Teil seiner Existenz dar. Spuren dieses Lesens durchziehen sein Werk – von den „Stahlgewittern“ bis zu „Siebzig verweht V“: Um Jünger zu verstehen, muß man diesen Spuren folgen, leiten Sie doch zu Bedeutungsräumen, die hinter dem Text verborgen liegen. Jünger lesen heißt also „Spuren-Lesen“. Diese JF-Serie versucht einige Fährten aufzunehmen und ansatzweise zu entziffern. Und sie will natürlich auch zur Lektüre von Jüngers Lektüren anregen.