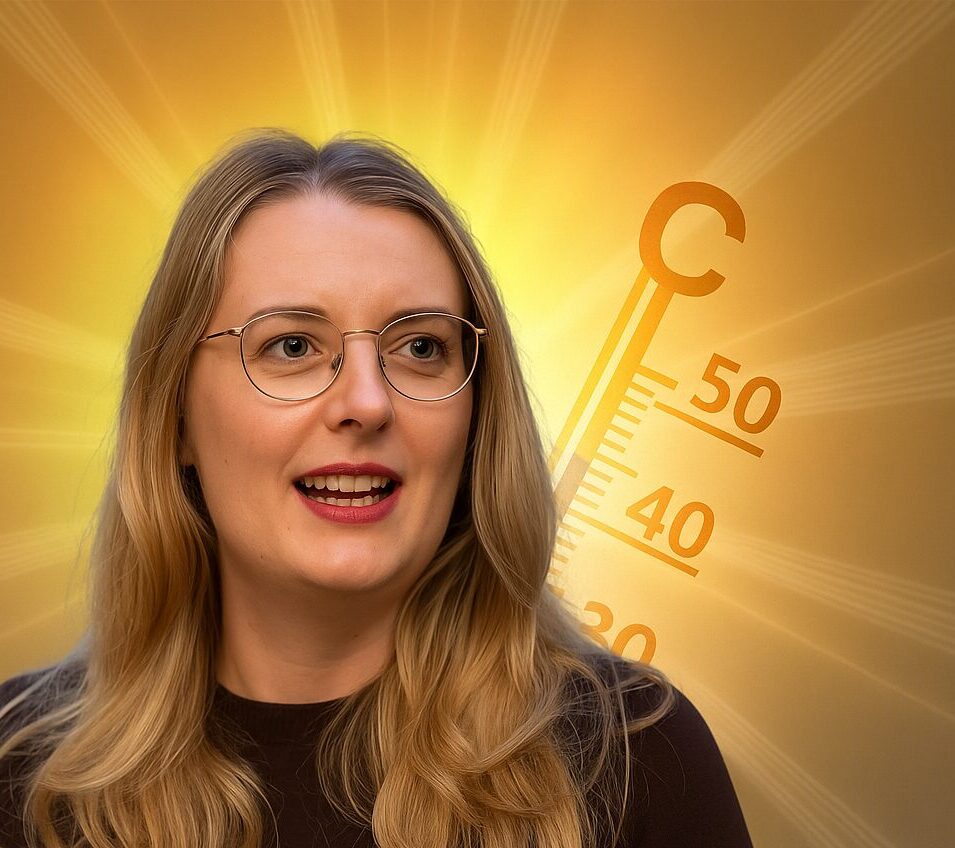In den Schreibstuben und Sendeanstalten kursiert ein neues Lieblingsthema. Der vor dem Kadi stehende Altbundespräsident? Die Europäische Zentralbank, die den Sparern ans Eingemachte geht? Die munter vor sich hin dilettierenden Groß-Koalitionäre in spe? Mitnichten. Prostitution heißt der Aufreger dieser Tage: Deutschland einig Dirnenland, Bordell Bundesrepublik, dieser Eindruck drängt sich geradezu auf.
Gründe dafür gibt es viele, drei lassen sich am leichtesten benennen: Der erste heißt ganz banal „Sex sells“; es ist die alte, wenn auch uncharmante Medienweisheit, daß sich Geschichten rund um Liebe und Triebe gut verkaufen. Wo – wie beim Blick auf das horizontale Gewerbe – Voyeurismus und Ekel gleichermaßen stimuliert werden können, ist mit höheren Verkaufszahlen beziehungsweise Quoten zu rechnen. Deftig bebildert, läuft die Sache von selbst.
Schon rollt die PR-Maschine
Grund Nummer zwei ist ebensowenig schmeichelhaft für die schreibende und sendende Zunft: Alice Schwarzer hat ein Buch wider die Prostitution geschrieben, zeitgleich mit dessen Erscheinen einen entsprechenden Aufruf in der Zeitschrift Emma veröffentlicht und von Prominenten unterzeichnen lassen – schon rollt die PR-Maschine.
Bleibt noch der dritte Grund, der redlicherweise nicht verschwiegen werden darf: Es gibt tatsächlich gravierende Mißstände, die es verdienen, öffentlich benannt und möglichst behoben zu werden. Es gibt Zwangsprostitution, es gibt Menschenhandel, es gibt Ausbeutung sowie Erniedrigung von Frauen. Es gibt Orte, in denen käuflicher Sex ganz offenkundig aus dem Ruder gelaufen ist, wo Unbeteiligte (auch Kinder) nicht umhinkommen, Zeugen der Anbahnung oder gar der „Verrichtung“ zu werden.
Ein gut gemeintes Gesetz
Vor allem aber gibt es ein Gesetz, das solche Mißstände zwar nicht verursacht, aber doch weiter befördert hat; obwohl es eigentlich ganz anders gemeint war. Das Prostitutionsgesetz, 2002 von der rot-grünen Koalition beschlossen, sollte mit nur drei Paragraphen das Rotlichtmilieu aus der rechtlichen Grauzone holen, sollte die soziale und rechtliche Stellung der Huren verbessern. Es sollte ihnen ermöglichen, Arbeitsverträge samt einer Sozial- und Krankenversicherung abzuschließen.
Seitdem, so die Intention, ist ihre Tätigkeit vom Makel der Sittenwidrigkeit befreit. Daraus folgt, daß Prostituierte ihre Entlohnung wie umgekehrt die Freier eine Dienstleistung einklagen können. Und das, so meinten die Verfechter von damals, mache das gesamte kriminelle Umfeld des Milieus überflüssig. Rechtsweg statt Lude, so einfach ist das. Pustekuchen.
Linke Idee trifft auf Wirklichkeit
Bereits fünf Jahre nach Inkrafttreten stellte eine Studie im Auftrag der Bundesregierung fest, daß nicht einmal ein Prozent der Prostituierten einen Arbeitsvertrag, die wenigsten eine Krankenversicherung haben. Stattdessen profitierten von der Neuregelung vor allem die Bordellbetreiber und Zuhälter, weil ihnen nicht mehr mit dem Straftatbestand Förderung der Prostitution gedroht werden kann. Das vermeintlich älteste Gewerbe der Welt prosperierte also dank eines der liberalsten Gesetze der Welt, sogenannte Flat-rate-Puffs eröffneten, die Zahl illegal eingeschleuster Huren stieg, die Preise sanken. Und wo früher Polizei, Ordnungs- und Gesundheitsämter aktiv werden konnten, sind sie mittlerweile auf die Zuschauerrolle beschränkt.
Wie so oft gilt auch hier: Linke Idee trifft auf Wirklichkeit – und wird von dieser widerlegt. Das mußten selbst diejenigen zähneknirschend eingestehen, die sich zuvor noch für den angeblich großen Wurf haben feiern lassen, vorneweg sozialdemokratische Politikerinnen, die in dieser Sache ungewöhnlich kleinlaut geworden sind und „Nachbesserungsbedarf“ sehen.
Prostitution – ein Beruf wie jeder andere?
Allerdings ging es den Protagonisten dieser Novellierung von 2002 auch nie allein um Wohl und Wehe derer, die auf den Strich gehen. Wie bei anderen gesellschaftspolitischen Projekten von Rot-Grün lag auch hier die Absicht vor, Werte umzuwerten, die Unterscheidung von normal und unnormal zu verwischen. Mit einem Federstrich stellte man fest: Prostitution – ein Beruf wie jeder andere. Es erklingt auch hier das alte Lied von der absoluten Gleichbehandlung. Und mit dem – scheinbaren – Widerspruch, Prostitution bisher zwar nicht als illegal, wohl aber als sittenwidrig zu deklarieren, schleifte man erklärtermaßen eine der letzten Bastionen bürgerlicher, sprich: männlicher (Doppel-)Moral.
Daß mit Alice Schwarzer nun ausgerechnet die Doyenne der nicht gerade als konservativ verschrienen Frauenbewegung dagegen Front macht, erklärt vielleicht die von schnippisch bis hysterisch reichenden Reaktionen. „Das linke und liberale Milieu hat total versagt in der gesamten Sexualpolitik“, meinte Schwarzer jüngst in einem Interview. Wenn sie allerdings meint, Prostitution sei mittlerweile „gesellschaftsfähig“, ja gelte „als cool“, erliegt sie demselben Irrglauben wie ihre Gegner, die meinen, mit drei Paragraphen ändere man ruck, zuck tradierte Moralvorstellungen.
Ein gewisser Pragmatismus ist angebracht
Bleibt abschließend die Frage, ob nur ein generelles Verbot von Prostitution die Antwort auf den permissiven Ist-Zustand sein sollte. Es spricht einiges dafür, daß sich dies als genauso kontraproduktiv erweisen könnte. Schließlich hat die Prohibition aus den Amerikanern keine Abstinenzler, sondern aus Chicago eine Hauptstadt des Verbrechens gemacht. Realpoltitik ist immer eine Gratwanderung:
Die pure Tatsache, daß es etwas „schon immer gegeben hat“, begründet noch keinen Anspruch auf Bestandsschutz. Andererseits ist zuweilen ein gewisser Pragmatismus mit Blick auf das letztlich Unvermeidliche durchaus angebracht. Der Staat hat die Ordnung aufrechtzuerhalten, nicht die Moral. Für sie ist eine andere Instanz zuständig, auf die im medialen Treiben nur selten verwiesen wird: das eigene Gewissen.
JF 48/13