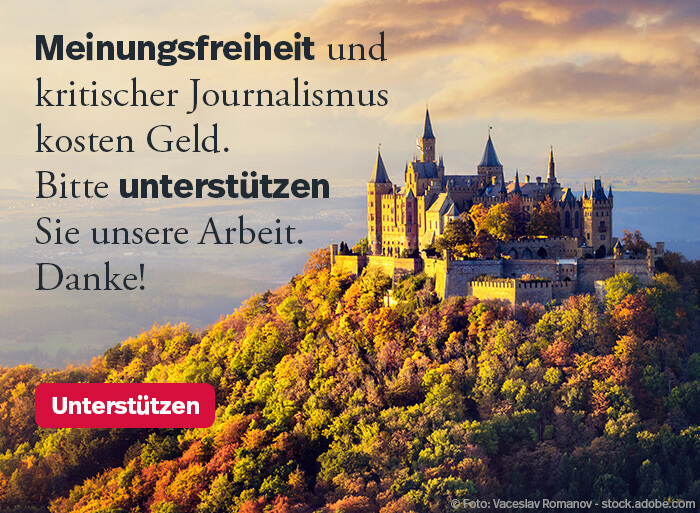Wem nichts Besseres einfällt, der spricht vom Wetter, heißt es. Trotzdem will Pankraz hier einmal eine Runde Wetter-Talk riskieren, denn alle sprechen vom Wetter, das kann eigentlich nicht nur an Einfallslosigkeit liegen. Vielmehr ist das Wetter das allgemeinst Verbindliche (Georg Simmel), jeder interessiert sich dafür, der eine mal mehr, der andere mal weniger, der verbale Austausch über das momentane Wetter stiftet sofort Gemeinsamkeit, zwar auf niedrigem, aber absolut sicherem Niveau.
Es sind keine Unhöflichkeiten zu befürchten, keine Indiskretionen, keine weltanschaulichen Differenzen. Der Wetter-Talk ist, um mit Jürgen Habermas zu sprechen, der herrschaftsfreie Dialog an sich und überhaupt. Das unterscheidet ihn beispielsweise von Gesprächen über das Klima, die bekanntlich mit Haß und Rankünen, mit Politik und Besserwisserei aufgeladen sind. Wohl spricht man auch im Wetter-Talk über Katastrophen, über Blitzeinschläge, verheerende Windhosen oder sintflutartige Regenfälle. Aber niemand wird dafür verantwortlich gemacht.
Der Wettergott ist, bei aller zeitweiligen Zornigkeit und prinzipiellen Unzuverlässigkeit, ein guter Gott, mit dem niemand rechtet. Sein modernes Symbolbild ist jener aus der Chaostheorie bekannte winzige, feine Schmetterling, der irgendwo im fernen Japan an einer Kirschblüte nuckelt und dabei fast wie im Traum die Flügelchen bewegt Aus diesem Flügelschlag, so lehrt die Chaosforschung, können in Europa die finstersten Wolkengebirge und die gräßlichsten Gewitter entstehen.
Man freut sich an schönem Wetter, seufzt über schlechtes Wetter, aber niemand möchte aufs Wetter verzichten. Weltgegenden, in denen es nur Klima gibt, dagegen kaum Wetter, lösen Mitleid aus oder heimliches Grauen. Die Wüste Atacama zum Beispiel, wo tagsüber immer die Sonne scheint und es konstant um die vierzig Grad heiß ist und wo es vielleicht alle fünf Jahre nur einmal kurz regnet. Mit Erschütterung sieht der Naturfreund nach einem solchen Geschenkregen, wie sich die Wüste urplötzlich in schier wahnwitziger Eile belebt und einen wahren Triumphtanz der Schöpfung absolviert.
Pflanzenkeime, die dort jahrelang tief unter der Erde gelegen haben, schießen raketenhaft empor und entfalten sagenhafte Blütenpracht. Urtümliche Kröten und anderes Getier, das in einen steinähnlichen Mantel aus selbsterzeugtem Schleim gehüllt nicht minder tief und nicht minder lange geschlafen hat, wacht endlich auf, kriecht hervor, schnappt nach Luft, frißt sich gegegenseitig auf, zeugt mit äußerster Geschwindigkeit Nachkommen (die dann sofort wieder im Erdboden verschwinden, einen eigenen Schleimpanzer ausspucken und auf das nächste Geschenkwetter warten).
Nicht nur der Mensch, die Natur im Ganzen ist offenbar in erster Linie wetterabhängig, nicht klimaabhängig. Sie leistet lebensfeindlichem Klima lange Widerstand, sofern ihre Gene nur wissen, daß man sich und seis über größte Zeiträume hinweg aufs Wetter verlassen kann. Für die menschliche Kultur lautet die Formel kaum anders. Der Mensch ist primär ein Wettertier, kein Klimatier.
Die Kultur benötigt, um sich in all ihren Dimensionen aufs Schönste entfalten zu können, ein gemäßigtes Klima, sagte der große Klimaphilosoph Montesquieu im achtzehnten Jahrhundert. Pankraz würde heute eher sagen: Die Kultur benötigt eine einigermaßen variantenreiche und kalkulierbare Wetterskala. Natürlich ist eine solche Skala vom Klima abhängig, doch sie ist nicht mit ihm identisch, fast im Gegenteil: Das wechselnde Wetter unterläuft das herrschende Klima gewissermaßen, sorgt für Abweichung von der Regel, für Abwechslung. Und was ist der Kultur zuträglicher als Abwechslung?
Klima formiert Raum, Wetter formiert Zeit. Im Lateinischen sind die Wörter für Zeit und für Wetter faktisch identisch, denn die Zeiten, Tageszeit wie Jahreszeit, wurden weitgehend am Verlauf des Wetters gemessen. Die klassischen Sprachen kannten übrigens nur Wetter, kein Klima: das griechisch-römische Wort clima meinte ganz allgemein kulturfremde, äquatoriale Zustände, wo es nach damaliger Kenntnis gar kein wirkliches Wetter gab, wo es immer bloß heiß und trocken und gleichförmig blieb.
Bemerkenswert auch, daß dem Begriff des Wetters generell von Anfang an eine (zeittreibende, auf Beschleunigung angelegte) Unheilskomponente innewohnte. Schönes, ruhiges Sommerwetter war für die Griechen und Römer im Grunde gar kein richtiges Wetter; das kam erst, wenn Stürme rauschten und Regenfloten niedergingen, Blitze zuckten und der Wettergott seine Wolken gegeneinanderkrachen ließ. Moderne Sprachen haben durchaus einiges von dieser Auffassung übernommen. Wenn man im Deutschen oder Englischen mit widerwilliger Anerkennung von einem richtigen Wetter spricht, dann meint man Sturm und Donnerschlag.
Und was für das Wetter gilt, gilt immer auch für Zeit und Geschichte. Schöne Tage sind leere Blätter im Buch des Lebens darin waren sich Goethe und Hegel ausnahmsweise einmal einig.
Bei zahlreichen historischen Großereignissen hat tempest, also stürmisches, schlechtes Wetter eine Rolle gespielt, machmal die entscheidende. Es hat die Brunnen von belagerten Festungen aufgefüllt und durchnäßte Belagerer zum Abzug gezwungen, es hat großangelegte Feldzüge durch vorzeitigen Wintereinbruch zum Scheitern gebracht. Und ganze Kriege entschieden.
Nicht vergessen sollte man darüber die friedliche und konstruktive Rolle des Wetters, ob nun gut oder schlecht. Es hat Poeten und Komponisten zu unsterblichen Werken inspiriert, es hat solche schönen, nützlichen Wissenschaften wie Meteorologie und Wettervorhersage hervorgebracht. Und es hat nicht zu vergessen die Volkssprache immer wieder zu hübschen Neubildungen verführt, vom Kaiserwetter bis zum Wetterfrosch. Dem Wetter sei Dank!