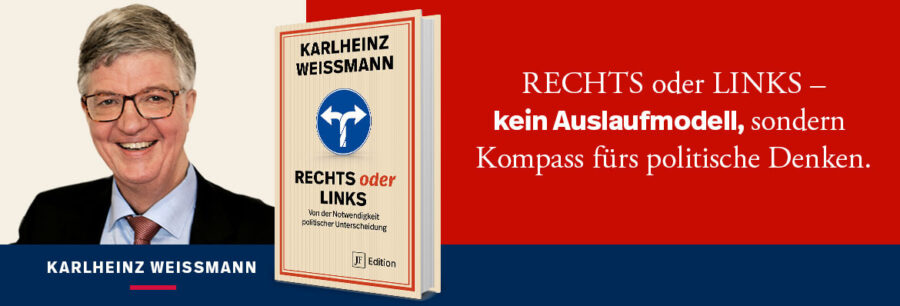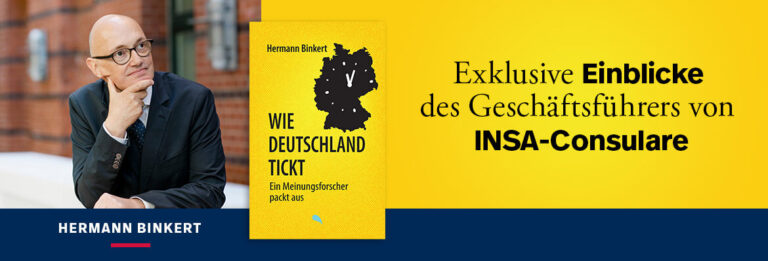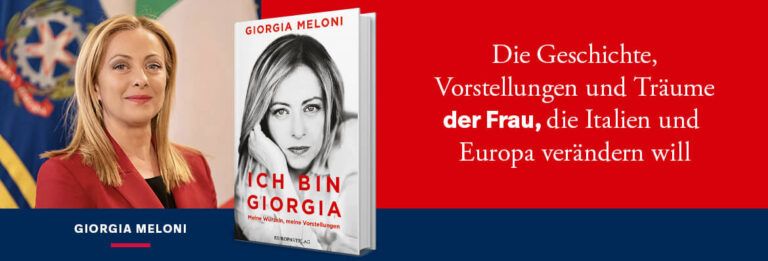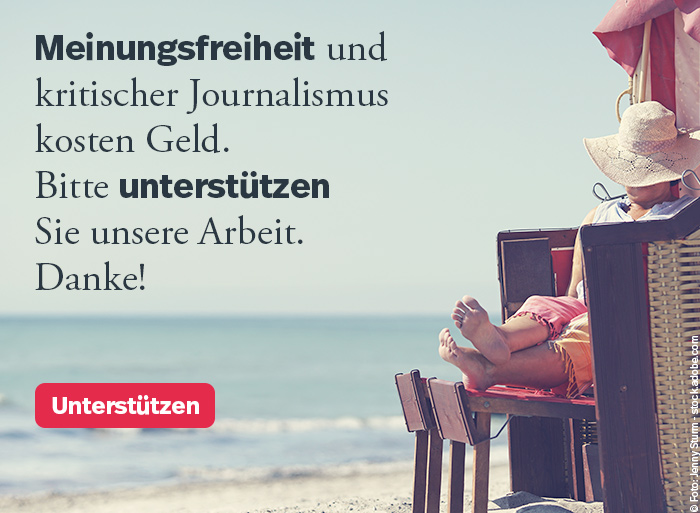Fragt man nach den großen „Krawallieros“ der Literaturgeschichte, fallen meist die drei Franzosen – Bloy, Céline und Artaud – ein. Dabei könnte man ihnen den Augustinermönch Abraham a Sancta Clara problemlos zur Seite stellen. Der wurde 1644 als Johann Ulrich Megerle geboren – ein Wirtssohn aus dem süddeutschen Kreenheinstetten. Als Endzwanziger begann seine Karriere als Feiertags- und Sonntagsprediger. In legendären Ansprachen donnerte Abraham a Sancta Clara gegen Reichtum, Hedonismus und Sittenverfall.
Gepfeffert mit surrealistischem Witz und Sprachspiel, riß er derbe Zoten über das ewige Trauerthema Mann und Frau: Eine unbändige Prophetenstimme aus der Tiefe, voller Wut, Sarkasmus und leider auch Repression. Beispielsweise gegen die Juden, die er mit – damals üblichen – Klischees traktierte, sie als Nachfolger der Gottesmörder und Brunnenvergifter schmähte. Im Kontrast dazu stand seine Bewunderung für alttestamentarische Persönlichkeiten. Aber nicht seine Pöbeleien, sondern die Wiener Pestepidemie trieb den Prediger zur sprachlichen Höchstform.
Seitenweise Schreckenslitanei
1680 erschien der Traktat „Mercks Wienn“, wo er in packender Bildsprache den Schrecken des ewigen Siegers Tod beschwört. Das Leben ist ihm nur ein Nebel, so hauchdünn: „O Mensch laß dirs gesagt seyn / laß dirs klagt seyn / schrey es auß / vnnd schreib es auß / allen / alles /allenthalben / Es muß gestorben seyn / nicht vielleicht / sonder gewiß. Wann sterben / ist nicht gewiß; wie sterben / ist nit gewiß; wo sterben / ist nicht gewiß; aber sterben ist gewiß. Auff den Frühling folgt der Sommer / auff den Freytag folgt der Samstag / auff das dreye folgt das Viere / auff die Blüe folgt die Frucht / auff den Fasching folgt die Fasten / ist gewiß / auff das Leben folgt der Todt / Sterben ist gewiß. Leben vnd Glaß / wie bald bricht das / Leben vnnd Graß / wie bald verwelckt das / Leben vnd ein Haaß / wie bald verlaufft das.“
Seitenweise hämmert der Autor seine Schreckenslitanei. Vergleichbar mit modernen Horror-Regisseuren, die dem Publikum – nicht mehr mit dem Sensen- , sondern durch den Motorsägen-Mann – Szene für Szene die Endlichkeit organischen Lebens demonstrieren. Und wenn die Täter dabei noch unbeteiligt lachen, ihre Opfer verhöhnen wie in Wes Cravens „The Last House on the Left“ (1972), werden sie vollends zu Platzhaltern vom Freund Hein.
Wiege der modernen Existenzphilosophie
Martin Heidegger glaubte in zweierlei Hinsicht, daß Abraham a Sancta Clara zu seinen Vorfahren gehörte – sowohl geistig als auch genealogisch. Schon 1910 hielt der junge Theologiestudent eine Festrede auf den Landsmann, beklagte darin die oberflächliche Neuerungswut der Gegenwart, die nur auf Augenblickreiz spekuliere und den „Jenseitswert“ des Lebens vergesse. Den sollte Heidegger 16 Jahre später in „Sein und Zeit“ (1927) ebenfalls versenken, nicht aber die unbarmherzige Todesgewissheit des Predigers. Besonders durch „Mercks Wienn“ geprägt, erkannte der Philosoph die menschliche Existenz als „Sein zum Tode“ – und das Verharren in der Todesangst als „eigentliches“, nicht entfremdetes Dasein.
Natürlich hielt er das nicht lange aus und ersetzte die „Angst“ bereits zwei Jahre später durch die „Langeweile“. Mag Heideggers Angst zum Tode auch durch Kierkegaard inspiriert sein, eingestimmt wurde der Denker schon lange zuvor durch Abraham a Sancta Clara. So sang der alte Barockdichter seine düsteren Lieder an der Wiege moderner Existenzphilosophie – und ging vor 300 Jahren, am 1. Dezember 1709, den Weg allen irdischen Fleisches.