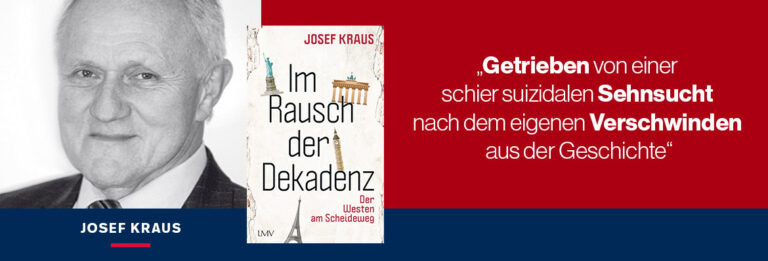Den Schlußpunkt im langwierigen Gesetzgebungsverfahren setzt herkömmlicherweise das Staatsoberhaupt. Es obliegt dem Bundespräsidenten nach Artikel 82 des Grundgesetzes, "die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze" auszufertigen und im Bundesgesetzblatt zu verkünden. Seit Beginn der Bundesrepublik gibt es Streit darüber, ob der Bundespräsident – gern wird der verkehrte Begriff eines "Staatsnotars" verwendet – die Gesetzentwürfe in Kraft zu setzen habe, oder ob ihm ein (wie bemessener?) Entscheidungsspielraum zusteht.
Aus dieser Frage wurde schon zur Weimarer Zeit ein Spielfeld für den Streit der Theorien. Das setzte sich in der Bundesrepublik fort. Jetzt flammt eine heftige Diskussion auf. Darüber gerät der juristische Meinungsstreit zu einem veritablen Konflikt, der seinen fatalen Reiz dadurch bekommt, daß Horst Köhler der CDU nahesteht und von der jetzigen CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Amt gebracht wurde. Die an Streit – zumal wenn er zwischen politischen Kräften entbrennt, die an sich einig zu sein haben – interessierten Medien leiten aus jeder einschlägigen Äußerung eine Abschätzung der Lebenserwartung der Großen Koalition aus Union und SPD ab.
Köhler hat binnen relativ kurzer Zeit zwei Gesetzentwürfe angehalten. Beschaut man die betroffenen Gesetze näher, zeigt sich, daß Köhler nicht etwa geleitet wurde von inhaltlich-politischen Bedenken. Gegen das von Köhler letzthin angehaltene Verbraucherinformationsgesetz sprechen nach seiner Ansicht durchaus keine inhaltlichen Gründe. Vielmehr findet der Bundespräsident, der Bundesgesetzgeber sei nicht berechtigt, Verpflichtungen von Gemeinden zu statuieren. Die Frage bekommt verfassungsrechtliche Würze dadurch, daß sich dies aus der Neufassung der Kompetenzordnung des Grundgesetzes ergibt, der sogenannten Föderalismusreform.
Bisher haben alle Bundespräsidenten von einem Prüfungsrecht bei der Ausfertigung und Verkündung von Gesetzen Gebrauch gemacht. Ein früher "Fall" von 1961 bezeichnet die seither weitergeführte Linie. Betroffen war ein Gesetz gegen den Betriebs- und Belegschaftshandel. Es ging nicht darum, daß sein Inhalt dem damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke (CDU) mißfiel. Vielmehr handelte es sich auch damals um einen kompetenzrechtlichen Zweifel. Die Bundespräsidenten haben, so sieht es aus, darauf Bedacht genommen, ihr Prüfungsrecht gegenüber Gesetzen nicht verkümmern zu lassen. Sie haben andererseits ihr Prüfungsrecht an Gesetzentwürfen ausgeübt, die nicht den Kern politischer Grundauffassungen betrafen.
Daraus folgte, daß von solchen Meinungsverschiedenheiten zwischen Staatsoberhaupt und politischen Instanzen nur zurückhaltend Kenntnis genommen wurde. Jetzt aber fallen Worte wie Amtsanmaßung oder Selbstüberschätzung des Präsidenten bei den Regierenden, und in einer Großen Koalition sind das CDU/CSU und SPD. Die Rede geht, daß Köhler aus dem Bundespräsidialamt eine Gesetzgebungs-Prüfstelle machen wolle, und es heißt, Köhler reagiere seine Enttäuschung über die jetzt Regierenden ab, die mit ihrem Reformeifer hinter seinen Erwartungen zurückblieben. Das aber liegt dicht bei dem Vorwurf der Parteilichkeit, und das ist für den auf Überparteilichkeit verpflichteten Bundespräsidenten ein Vorwurf von fast nicht überbietbarer Schärfe.
Sozialdemokraten schüren den Streit, indem sie den früheren Bundespräsidenten Johannes Rau, der bekanntlich einer der Ihren war, zum Vorbild für Horst Köhler machen. Sie meinen, Rau habe musterhaft gehandelt, als er das Zuwanderungsgesetz der rot-grünen Koalition verkündete, aber gleichzeitig seine Bedenken zu Protokoll gab und die Politik aufforderte, das von ihm eigentlich doch als verfassungswidrig angesehene Gesetz dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorzulegen.
Das berührte immerhin eines der wichtigen Argumente verfassungsrechtlicher Art. Diejenigen, die dem Bundespräsidenten ein Prüfungsrecht bei der Gesetzgebung rundheraus versagen, begründen das mit der Existenz und der von der Verfassung vorgegebenen Rolle des Bundesverfassungsgerichts. Die Süddeutsche Zeitung sprach in einer zugespitzten Artikelüberschrift vom "Bundespräsidenten als Verfassungsrichter". Davon kann indes nicht die Rede sein. Denn ein Staatsorgan kann nicht von der Verfassung verpflichtet sein, evident verfassungswidrigem Recht zur Geltung zu verhelfen.
Doch wann liegt eine evidente Verfassungswidrigkeit vor? Jedenfalls bei einer Nicht-Beachtung von Verfahrensvorschriften. Heikel wird es bei der Prüfung auf Inhaltliches. Hier wäre die Entscheidung dann doch am besten beim Bundesverfassungsgericht aufgehoben, wo acht Richter, berufen nach politischem Proporz, verbindlich sagen, was die Verfassung verlange. Die Politiker täten gut daran, von den Versuchen abzulassen, einen Bundespräsidenten, der ihnen nicht paßt und der ihre Kreise stört, auf ungehörige Weise zu tadeln. Im fernen Jahr 1963 hat der Staatssekretär im Innenministerium, Georg Anders, den Vorschlag gemacht, dem Bundespräsidenten durch Gesetz das Recht zu geben, bei Zweifeln über die Verfassungsmäßigkeit eines ihm zur Ausfertigung und Verkündung vorgelegten Gesetzes das Bundesverfassungsgericht zur letztverbindlichen Entscheidung anzurufen. Dieser Vorschlag hat auch über 40 Jahre später nichts an Aktualität eingebüßt.