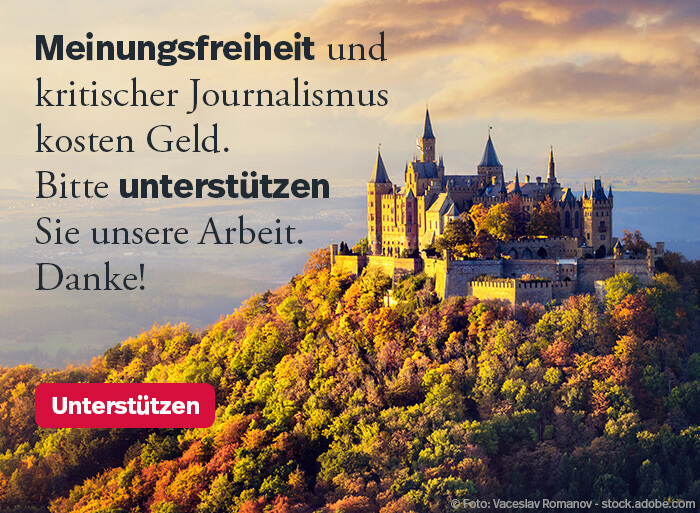Freitag, der 15. August war der Tag, an dem ein Ende des seit mehr als drei Jahren tobenden Krieges in der Ukraine näherrückte. Noch in der Nacht starben Zivilisten in ukrainischen Städten, hatte die Ukraine eine Ölraffinerie bei Samara und einen Hafen im Wolgadelta bombardiert.
Dann trafen sich der US-amerikanische und der russische Präsident auf einem Luftwaffenstützpunkt in Alaska. Sie sprachen fast drei Stunden miteinander. Danach erklärte Donald Trump vor der internationalen Presse, die Gespräche seien „extrem positiv“ verlaufen. Sie hätten sich in vielen Punkten geeinigt, in einem wichtigen aber nicht. Mehr wollte Trump nicht verraten.
Die westlichen Leitmedien reagierten überwiegend negativ. Im deutschen Fernsehen war die Rede von einer „Luftnummer“. Die Neue Zürcher meinte, die Konferenz habe ergebnislos geendet. Und die FAZ beschimpfte, statt zu analysieren. Sie nannte Putin einen Paria und Trump „geltungssüchtig und profitgierig“. Er sei Putin in die Falle gegangen, schrieb das Blatt noch an diesem Montag.
Da machte sich Wolodymyr Selenskyj mit großem europäischen Begleitschutz schon auf den Weg nach Washington. Die Regierungschefs aus Europa hatten Konzessionen im Gepäck, die sie bisher abgelehnt hatten: territoriale Zugeständnisse an den Kreml und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt der Ukraine. Der Prozeß der Diplomatie, den die Europäer so lange gescheut hatten, war endlich in Gang gekommen. Die Vorstellung, man könne einen Krieg beenden, ohne mit der Kriegspartei zu sprechen, die das Momentum der Offensive auf ihrer Seite hat, hatte sich als absurd erwiesen.
Ukraine sollte zum geostrategischen Hebel verkommen
Die Gespräche am Montag im Weißen Haus verliefen freundlich und besser als erwartet, brachten aber keinen Durchbruch. Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Kollegen aus der EU beharrten auf einem baldigen Waffenstillstand. Jetzt liegt der Ball bei Putin und Selenskyj. Sie sollen sich zu einem Gespräch unter vier Augen treffen – laut Merz schon innerhalb von zwei Wochen. Bei einem Dreiergipfel soll dann auch Trump dabeisein. Bis dahin bleibt alles offen, die Verhandlungen können immer noch scheitern.
Wenn sie sich ehrlich machten, müßten die EU-Europäer eine negative Bilanz ihrer Ukrainepolitik ziehen. Sie war geprägt von Wunschdenken und Fehleinschätzungen. Die vielen Sanktionspakete zwangen Rußland eben nicht in die Knie, international isoliert war der Kreml nie, die Hoffnung auf einen militärischen Sieg der Ukraine erwies sich als Trugbild.
Die Rolle der Europäer bestand im Grunde darin, daß sie die Rußlandpolitik der Biden-Regierung nachvollzogen. Sie wollten nicht akzeptieren, daß mit Trump ein anderer Wind in Washington wehte. Während er in Rußland grundsätzlich keine Gefahr sah, erzählten sie ihrem Publikum, die Russen würden weitere Länder überfallen, sobald sie mit der Ukraine abgeschlossen hätten.
Trump ist bereit, russische Sicherheitsinteressen zu respektieren, die Europäer halten sie für unberechtigt und vorgeschoben. Zur langen Vorgeschichte des Krieges gehört auch, daß Zbigniew Brzezinski, der neben Henry Kissinger einflußreichste frühere Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Rußland erklärtermaßen in drei Staaten aufteilen wollte. Oder daß die Ukraine nach dem Umsturz des Jahres 2014 von der CIA und Nato-Militärs zu einem Anti-Rußland aufgebaut wurde. Die Strategie der Neocons, mit der Trump gebrochen hat, bestand darin, Rußland zu schwächen und in die Enge zu treiben. Dabei fungierte die Ukraine als geostrategischer Hebel.
Moskau lehnt Nato-Truppen in der Ukraine ab
Offenbar machte Trump Putin in Alaska das Zugeständnis, noch vor einem Waffenstillstand über die Grundzüge des Friedensabkommens zu verhandeln. Selenskyj hat das bisher abgelehnt, weil ein sofortiger Waffenstillstand ihm die Gelegenheit verschaffen würde, seine erschöpften Truppen zu regruppieren, aufzufrischen und die eigene Verhandlungsposition zu versteifen.
Inzwischen sickerten Einzelheiten darüber durch, wie ein Abkommen aussehen könnte. Demnach würde Kiew mit dem Dnjepr als Demarkationslinie de facto auf einen Teil der Oblaste Cherson und Saporischschja verzichten, auf den Oblast Luhansk ganz und zumindest auf den besetzten Teil von Donezk. Die Krim ist ohnehin verloren. Im Gegenzug würden sich die russischen Truppen aus den weitaus kleineren Territorien bei Charkow und Sumy zurückziehen.
Der Verzicht auf die Nato-Mitgliedschaft ist eine unabdingbare Voraussetzung des Kreml. An der von Kiew verlangten Sicherheitsgarantie würden sich die USA jetzt doch beteiligen, so die jüngsten Signale aus Washington. Genau hier liegt der Teufel im Detail. Moskau lehnt europäische Nato-Truppen auf ukrainischem Territorium ab. Polen und Deutschland sehen das bisher genauso.
Ein Friedensabkommen ist laut Republikanern in Reichweite
Putin hätte viel erreicht, nicht aber sein ursprüngliches Ziel des im Frühjahr 2022 gescheiterten Blitzkriegs: die Installation eines Satellitenregimes in Kiew. Die ganze Ukraine zu erobern und zu halten muß eine Horrorvorstellung für den Kreml sein. Dafür ist das Land, auch dank gründlichem CIA-Training, zu gut für den dann zwangsläufigen Kleinkrieg vorbereitet.
Auch ein anderes Kriegsziel, nämlich die sogenannte Denazifizierung und Demilitarisierung, werden die Russen abschreiben müssen. Die Ukraine würde als souveräner Staat bestehen bleiben. Mit dem russisch geprägten Donbass haben die Bürger von Kiew und Lemberg ohnehin immer gefremdelt. Laut Volkszählung von 2001 lebten in der Ukraine 76 Prozent Ukrainer, 17 Prozent Russen. Insgesamt 30 Prozent der Bürger sprachen Russisch als Muttersprache. Nach dem Friedensabkommen wäre die Ukraine ein homogener Staat mit nationalistischer Grundierung.
Ebendieser Nationalismus hat den oftmals heroischen Widerstand gegen die Aggressoren getragen. Die Ukrainer werden die absehbaren Wiederaufbau-Milliarden der EU gern entgegennehmen. Dem Postnationalismus der EU-Kommission werden sie sich nicht beugen. Die EU wird zu einem interessanten Gebilde mutieren, wenn sie erst einmal dabei sind.
Ganz geschlossen steht auch das Establishment der Republikanischen Partei nicht hinter Trump. Aber selbst Lindsey Graham, der republikanische Falke im Senat, der bereits ein hartes Sanktionspaket gegen Moskau und seine Handelspartner auf den Weg gebracht hat, sieht jetzt ein Friedensabkommen noch vor Weihnachten in Reichweite. Abba Eban, israelischer Außenminister von 1966 bis 1974, sagte einmal: „Die Geschichte lehrt uns, daß Menschen und Nationen sich weise verhalten, sobald sie alle Alternativen ausgeschöpft haben.“