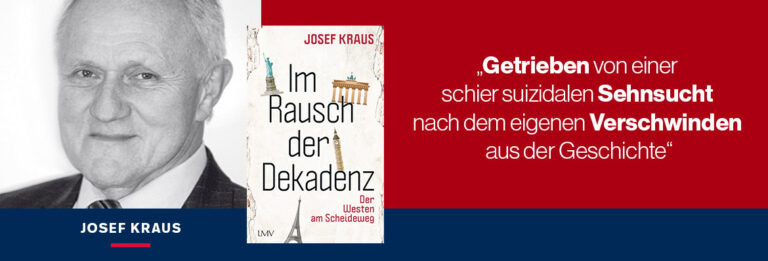Seit drei Jahren propagiert die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen (BdV), Erika Steinbach, eine Idee, deren Umsetzung jetzt allerhöchste Zeit wird: Das „Zentrum gegen Vertreibung“, das nach dem Willen des BdV in Berlin errichtet werden soll. Zwar gibt es in Deutschland eine Reihe von regionalen und landsmannschaftlichen Einzelaustellungen und Einrichtungen, aber eine Möglichkeit, sich über die monströse Völkerverschiebung nach 1945 einen umfassenden und wissenschaftlich fundierten Überblick zu verschaffen, besteht bis heute nicht. Die Pläne sehen ein Gebäude von 11.000 Quadratmeter Nutzfläche in zentraler Lage vor. Es soll unter anderem ein Archiv für schriftliche, mündliche oder bildliche Zeitzeugenberichte enthalten, weitherhin eine Bibliothek, ein Dokumentations- und Ausstellungszentrum sowie Tagungsräume und Büros. Eine Gedenkrotunde soll Raum zur Andacht und Besinnung geben. Der BdV legt Wert darauf, daß dieses Zentrum nicht nur die Vertreibung der Deutschen dokumentieren soll. Weltweit sind im 20. Jahrhundert zwischen 80 bis 100 Millionen Menschen von Vertreibungen betroffen gewesen. Der BdV hat eine Stiftung gegründet, die einen Kapitalstock anlegt und konzeptionelle und organisatorische Vorarbeit leistet. Spenden werden gesammelt, Benefizkonzerte veranstaltet. Die Erlöse daraus sind natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die entstehenden Kosten werden auf 80 Millionen Euro veranschlagt. Das Projekt kann also nur durch die Beteiligung von Bund und Ländern verwirklicht werden. Vom Bund wird außerdem erwartet, daß er ein repräsentatives Gebäude zur Verfügung stellt. An die Kommunen hat Frau Steinbach die Bitte übermittelt, der Stiftung zehn Pfennig (fünf Cent) pro Einwohner zur Verfügung zu stellen. Die Reaktion unionsgeführter Länder und Gemeinden ist eher positiv, die der SPD zögerlich. Die Fronten weichen freilich auf. In Darmstadt hat die rotgrüne Mehrheit beschlossen, das Zentrum zu untersützen, worauf die Stadtratsfraktion der PDS/DKP feststellte: „Hier wird mit öffentlichen Geldern ein Wallfahrtsort für Rechtsextremisten gebaut und die Stadt Darmstadt baut mit.“ Im schönsten SED-Deutsch wird weiter behauptet: „Die ‚Vertriebenen‘ waren in ihrer großen Mehrheit Wegbereiter für den Überfall Nazideutschlands auf seine Nachbarn und die darauf folgende Ermordung von Millionen von Juden und Osteuropäern in der Tschechoslowakei, Polen und der ehemaligen Sowjetunion.“ So ein Vokabular gilt heute weithin als unfein, aber die Stimmungslage, die sich darin niederschlägt, ist noch immer verbreitet. Die BdV-Präsidentin versucht daher, für das Projekt Persönlichkeiten zu mobilisieren, die sonst nicht mit dem BdV in Verbindung stehen. Eine zentrale Rolle nimmt der ehemalige SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz ein, der an der Universität St. Gallen eine Professur innehat. Glotz hatte sich in den letzten Jahren mit scharfen Worten gegen die Verharmlosung der Vertreibung und der BenesDekrete gewandt, ohne deshalb etwaige Restitutionsansprüche zu teilen. Für ihn ist der Aufklärungs- und Verständigungsanspruch des Zentrums auch ein sehr persönliches Anliegen: Sein Vater war Sudetendeutscher, seine Mutter Tschechin. Nach der Angliederung des Sudetenlandes an das Reich wurde sein Vater aufgefordert, sich von seiner Frau zu trennen. Nach 1945 übten die tschechischen Behörden entsprechenden Druck auf seine Mutter aus. Auf der Prominentenliste stehen auch Arnulf Baring, Guido Knopp – er hat der Stiftung 1.000 seiner Videointerviews zur Verfügung gestellt – und die DDR-Bürgerrechtlerin Freya Klier, die die Verschleppung ostdeutscher Frauen in russische Zwangsarbeitslager erstmals in einem Buch thematisierte. Der tschechische Historiker Bohumil Dolezal, der die deutsch-tschechische Erklärung 1997 von vornherein für einen faulen Formelkompromiß gehalten hat, unterstützt das Anliegen ebenfalls. Diese Namen sind durchaus eindrucksvoll, doch handelt es sich um einschlägige Einzelgänger. Den meisten erscheint es nach wie vor karriereschädigend, sich mit einem Vertriebenenprojekt zu identifizieren. Innenminister Schily hatte schon prinzipielle Zustimmung signalisiert, als Bundeskanzler Gerhard Schröder im September 2000 bei einem Auftritt vor Vertriebenen die Idee ablehnte. Offenkundig war er von seinem damaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann instruiert worden, der das Projekt noch heute „hemmungslos deutschtümelnd“ findet. Frau Steinbach, die 1943 in Westpreußen geboren wurde, weiß, obwohl sie das so direkt nicht sagt, daß es um das Vermächtnis des BdV geht. Die Idee des Zentrums bietet der Organisation, die in den letzten Jahren nur Niederlagen hinnehmen mußte und bereits aus demographischen Gründen die Zukunft hinter sich hat, ein letztes Mal Gelegenheit, in die Offensive zu gehen. Steinbach selber kann ihre rhetorischen Fähigkeiten nur deshalb öffentlich zur Geltung bringen, weil sie, als Mitglied der CDU/CSU-Fraktion, das Podium des Bundestages zur Verfügung hat. Als Verband wird der BdV praktisch nicht mehr gehört. Den Umzug nach Berlin hat er verschlafen, sein wöchentliches Informationsblatt Deutscher Ostdienst (DOD) erscheint ab April als Monatsmagazin, was mit finanziellen Problemen, aber auch mit der fehlenden Relevanz und Resonanz zusammenhängt. Alfred Jebens, seinerzeit Geschäftsführer des Ostdeutschen Kulturrates, warf in einem Interview den Altfunktionären des BdV vor, Kulturstaatsminister Naumann 1999/2000 bei der Abwicklung ostdeutscher Kultureinrichtungen de facto assistiert zu haben. Sie seien an der „falschen Einschätzung der politischen Lage und ihrer Position (gescheitert), am Glauben an ihre Unersetzbarkeit und an ihrer Mißachtung der Ministerien“. Die Erinnerungsarbeit wird nun aus dem Gestrüpp der öffentlichen Vorurteile, aber auch der Funktionäre, eifersüchtelnder Landsmannschaften und der Verbandsquerelen befreit. Die Chancen scheinen auch deshalb nicht schlecht zu stehen, weil die Vertreibung ein europäisches Thema ist, an dem auch die politische Linke in Deutschland nicht mehr vorbei kann. Doch muß man sich vor Illusionen hüten. Je konkreter das Projekt Gestalt annimmt, um so heftiger wird der Gegenwind blasen. Das Zentrum gegen Vertreibung wird unweigerlich zum Thema innerhalb eines Kulturkampfes werden, der längst im Gange ist und sich gegen die Verengungen und Verklemmungen richtet, die seit den siebziger Jahren in der deutschen Geschichtspolitik üblich geworden sind. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Meckel hat einen besonders listigen Vorschlag gemacht. Nicht Berlin, sondern das heute polnische Breslau solle Sitz des Zentrums werden. Meckel ist Vorsitzender der deutsch-polnischen Gesellschaft und der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. Weder politisch noch intellektuell ist er irgendwie bedeutsam, aber gerade deswegen ein repräsentativer Vertreter der mittleren politischen Szenerie. 1990 drängte sich der brandenburgische Pfarrer danach, das DDR-Außenministerium zu übernehmen. In Verkennung der geschichtlichen Stunde versuchte er, in den „Zwei-Plus-Vier-Gesprächen“ eine eigene Rolle zu spielen, indem er penetrant die „Wahrung sowjetischer Interessen“ anmahnte. Genscher tat das einzig Angemessene: Er ignorierte ihn. Den Leiden nachträglich einen Sinn verleihen Natürlich muß das Zentrum seinen Platz in Deutschland, in Berlin, einnehmen. Das hat zum einen ganz praktische Gründe. Die Archivalien, die hier gesammelt werden, sind größtenteils deutscher Herkunft und werden folglich auch bei Deutschen das größte Interesse finden. Zum anderen ist das Zentrum eine Initiative der deutschen Vertriebenen, die zahlenmäßig die größte Betroffenengruppe sind und denen die Vertreibung audrücklich in ihrer Eigenschaft als Deutsche geschehen ist. Dieses Zentrum, das an ihr Schicksal erinnert und vor Wiederholungen warnt, wird ihrem Leiden nachträglich einen universellen Sinn verleihen und ihnen damit die Möglichkeit eröffnen, es wenigstens posthum und symbolisch zu besiegen. Weiter kann man in seinem Versöhnungsangebot und in der Überwindung nationaler Hybris gar nicht gehen. Die Organisationsstruktur des Zentrums dürfte noch einiges Kopfzerbrechen bereiten, weil hier die unterschiedlichen Ansätze und Interessen: die der Betroffenen und ihrer Nachkommen, der Wissenschaft, der Museumspädagogik und der Politik aufeinanderstoßen werden. Es wird nötig sein, eine Äquidistanz sowohl zu den Regierungen, als auch zu Verbänden und Lobbygruppen zu halten. Für das Zentrum sollte ein Neubau errichtet werden, der ähnlich zeichenhaft wie das von Daniel Libeskind entworfene Jüdische Museum in Berlin wirkt. Man könnte sich einen Grundriß vorstellen, der die Umrisse der ehemaligen deutschen Ostprovinzen aufnimmt. Die Oder-Neiße-Linie würde zunächst als glatte, abweisende Glaswand erscheinen, die beim Näherkommen durchsichtig wird und dem Besucher ihre Portale weit öffnet.